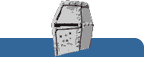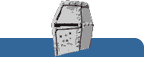| |
Kapitel
6. Gottschalk Daso in der Vision des Bauern Gottschalk
 us
dem Mittelalter sind rund 170 Visionsschriften bekannt, die Jenseitsreisen
von Menschen schildern. Der Visionär verfällt meist in
Ekstase oder Schlaf, seine Seele verlässt den Körper,
der wie tot zurückbleibt. Solche Berichte fanden im 12. Jahrhundert
einen ausgesprochenen Höhepunkt und gehörten zur erbaulichen
Literatur des Mittelalters.(1) us
dem Mittelalter sind rund 170 Visionsschriften bekannt, die Jenseitsreisen
von Menschen schildern. Der Visionär verfällt meist in
Ekstase oder Schlaf, seine Seele verlässt den Körper,
der wie tot zurückbleibt. Solche Berichte fanden im 12. Jahrhundert
einen ausgesprochenen Höhepunkt und gehörten zur erbaulichen
Literatur des Mittelalters.(1)
Zwei
der Visionstexte kommen aus dem holsteinischen Kernland. Sie schildern
die Visionserlebnisse eines Bauern. Die erste Visionsschrift wurde
mit hoher Wahrscheinlichkeit von Sido oder zumindest unter seiner
Aufsicht verfasst. Er war von 1177 bis 1204 Probst des Augustiner-Chorherrenstifts
von Neumünster.(2) Den zweiten Text hat
vermutlich ein Pfarrer aus Nortorf geschrieben. Wahrscheinlich ein
mit Sido befreundeter Kollege des Archidiakonats Hamburg.
Da
Sido von der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts eindeutig als Fälscher
überführt wurde, der sich Grund und Boden für seinen
Stift wiederrechtlich anzueignen bemühte, kann davon ausgegangen
werden, dass mit der Visionsschrift ähnlich unehrenhafte Ziele
verfolgt worden sind.
Mit
Hilfe der Visionsschriften, die über die Pfarrer in der Holsteinischen
Bevölkerung Verbreitung hätten finden können, sollte
der politische Boden für einen System-, Werte- und Führungsschichtwechsel
bereitet werden. Um die Glaubwürdigkeit der Schriften in der
bäuerlichen Bevölkerung zu untermauern, gaben die Visionsautoren
vor, die Texte völlig unabhängig von einander auf der
Grundlage von Befragungen des unter Visionen leidenden Bauern verfasst
zu haben. Letztlich ging es den Autoren um die Machtergreifung des
Adels und der Kirche im Land, die noch in der Leibeigenschaft der
meisten Holsten münden sollte.
Die
Autoren schildern in ihren Schriften die Nahtod- und Visionserlebnisse
eines Bauern namens Gottschalk. Solche Berichte von Personen, die
knapp dem Tod entgangen sind, kennen wir aus allen Kulturen und
Zeiten. Nur, dass in unserem Fall die Nahtoderlebnisse des Bauern
von den beiden Geistlichen mit einer verfärbten regionalen
Geschichte Holstein geschmückt wurden.
Nach
den Schilderungen lebte der Bauer Gottschalk (Godeschalcus) im Dorf
Großharrie. Dieser Ort lag eingekeilt zwischen dem Dosenmoor
im Nordwesten und dem dichten Urwald des Isarnho im Nordosten, am
nordöstlichen Zipfel des damaligen Kirchspiels Neumünster
in Holstein.(4)
 Über
Großharrie wird bereits bei Helmold berichtet, dass im Jahr
1155 eine erblindete Frau namens Adelburgis eine Vision gehabt habe,
in der ihr der bereits verstorbene Bischof Vicelin erschienen sei:
„Und sofort streckte er seine rechte
Hand aus und machte das hochwürdige Zeichen des Kreuzes über
ihren Augen und segnete sie. Als aber am Morgen die Frau erwachte,
merkte sie, dass durch Gottes Eingreifen zugleich mit dem Dunkel
der Nacht auch das Dunkel der Blindheit vertrieben war.“(5) Über
Großharrie wird bereits bei Helmold berichtet, dass im Jahr
1155 eine erblindete Frau namens Adelburgis eine Vision gehabt habe,
in der ihr der bereits verstorbene Bischof Vicelin erschienen sei:
„Und sofort streckte er seine rechte
Hand aus und machte das hochwürdige Zeichen des Kreuzes über
ihren Augen und segnete sie. Als aber am Morgen die Frau erwachte,
merkte sie, dass durch Gottes Eingreifen zugleich mit dem Dunkel
der Nacht auch das Dunkel der Blindheit vertrieben war.“(5)
Wir
wissen nicht, ob Vicelin der Frau Adelburgis einmal einen wertvollen
Hinweis gegeben hatte, wie der Ofen des Hauses besser abziehen könne.
In jener Zeit litten nämlich viele Menschen durch Qualm bedingt
an entzündeten Augen. Denkbar ist aber auch, dass in Großharrie
die im Mittelalter bekannten und Visionen auslösenden Drogen
wie Tollkirsche, Bilsenkraut, Stechapfel, Schierling oder Taumellolch
konsumiert wurden und somit die Spökenkieckerei dort eine Heimstätte
fand. Frau Adelburgis konnte sich aber glücklich schätzen,
dass sie als Visionärin nicht in den Jahren nach 1489 lebte,
als mit der Einführung des päpstlichen Hexenhammers die
Inquisitionszeiten angebrochen waren. Für die Menschen des
12. Jahrhunderts besaß eine Vision hingegen eine legitime
Aussagekraft.
Der
zweite Visionär aus jenem Ort, der Bauer Gottschalk, soviel
ist anzunehmen, gehörte zur ersten Generation von Holsten,
die dem Aufruf von Graf Adolf II. zur Landnahme im eroberten Osten
gefolgt war, denn sein Haus lag nur rund 2 km östlich vom Grenzbach
Dosenbek beziehungsweise vom holsteinischen Kernland entfernt. Hier
teilte er das Kolonialschicksal seiner Zeit mit anderen: In der
ersten Generation wartete der Tod, in der zweiten die Not und in
der dritten das Brot. Sein Land gehörte nach dem Güterverzeichnis
des Augustiner-Chorherrenstifts, das unter Aufsicht von Probst Sido
verfälsch wurde, zur Ausstattung des Stifts Neumünster,
an das der Bauer Gottschalk einen Zehnten abführen musste.(6)
Aber seine Felder sowie das Haus waren sein und er gehörte
auch nicht zu den Ärmsten, da er noch denen etwas abgab, die
noch weniger hatten. Obwohl er ein Pferd besaß, dass allerdings
bald krepierte, folgte er dem militärischen Dienst im Dezember
1189 barfuß. Kränklich war er ein Leben lang. Seine Frau
war halb blind und sein Sohn galt als Schwächling, womöglich
ein Schwachkopf (imbecillis). Mit ihnen musste er seinen Hof alleine
bewirtschaften, da seine beiden Töchter offensichtlich nicht
mehr Zuhause wohnten. Sein Leben bestand aus sehr harter Feldarbeit
bei schlechten Erträgen. Außerdem musste er Burg- und
Bohlenwegbau sowie Militärdienst als Preis für seine Freiheit
leisten.(7)
Ein
solches Leben am äußersten Rand der christlichen Welt,
deren Grenze mit dem Wald bzw. des Limes Saxoniae in Sichtweite
lag, war mehr als kärglich. Es gab nur wenige Möglichkeiten
diesem Elend zu entfliehen. Der sonntägliche Kirchgang bot
eine gewisse Abwechslung. Zudem gab die Religion dem Leben einen
Sinn. Der Lohn Gottes wartete, wenn auch erst im Jenseits.
In
gewisser Hinsicht war ein solches Leben ein Fortschritt. Noch eine
Generation zuvor galt bei den Holsten das alte Sachsenrecht, das
sich mit Blutrache, Diebstahl und räuberischen Überfällen
abfand. Zu dieser Generation gehörten die alten Bauernritter
wie einst Daso de Ennigge. Auch seine Söhne werden den weiteren
Aufbau eines feudalen Lehenssystems durch Graf Adolf II. mit Argwohn
verfolgt haben, sollten sie doch jetzt Abgaben leisten. Darüber
hinaus war ihre alte Ordnung zerschlagen worden und viele Holsten
durch Vorstufen der Leibeigenschaft ihrer Freiheit beraubt.
Nachdem
Adolf II. im Jahr 1164 einen militärischen Ratschlag des Holstenanführers,
Overbode Marcrad I., missachtet hatte, fiel der Graf bei einem Feldzug
von Herzog Heinrich dem Löwen gegen die Obotriten.(8)
Sein Sohn, Adolf III., trat später die Nachfolge an (1166-1202,
gestorben 1225). Der Herzog Heinrich der Löwe war inzwischen
auf dem Höhepunkt seiner Macht, als er 1168 die englische Prinzessin
Mathilde heiratete und 1172 eine Pilgerfahrt ins Heilige Land antrat.
 Heinrichs
Vetter, der Staufer Kaiser Friedrich I. Barbarossa,
war in Norditalien in schwere kriegerische Auseinandersetzungen
verwickelt und bat 1176 den Löwen um Unterstützung für
einen Italienfeldzug. Der Welfe, Heinrich der Löwe, der lehensrechtlich
zu dieser Hilfe nicht verpflichtet war, forderte als Gegenleistung
die Reichsvogtei Goslar. Doch Barbarossa verweigerte ihm diese und
so blieb Heinrich dem Schlachtfeld fern. Aus Rache sprach Barbarossa
die Reichsacht über den Löwen aus, entzog ihm 1181 alle
Reichslehen und vertrieb ihn für den Zeitraum von 1181 bis
1185 zu seinem Schwiegervater, König Heinrich II. von England.(9) Heinrichs
Vetter, der Staufer Kaiser Friedrich I. Barbarossa,
war in Norditalien in schwere kriegerische Auseinandersetzungen
verwickelt und bat 1176 den Löwen um Unterstützung für
einen Italienfeldzug. Der Welfe, Heinrich der Löwe, der lehensrechtlich
zu dieser Hilfe nicht verpflichtet war, forderte als Gegenleistung
die Reichsvogtei Goslar. Doch Barbarossa verweigerte ihm diese und
so blieb Heinrich dem Schlachtfeld fern. Aus Rache sprach Barbarossa
die Reichsacht über den Löwen aus, entzog ihm 1181 alle
Reichslehen und vertrieb ihn für den Zeitraum von 1181 bis
1185 zu seinem Schwiegervater, König Heinrich II. von England.(9)
In
diesen Wirren wechselte Graf Adolf III. noch rechtzeitig die Seiten
zu Gunsten des Kaisers und je nachdem, wie weit sich der Herzog
oder der Graf im Land durchsetzen konnten, wurden die Spitzenpositionen
in Holstein neu besetzt. Das holsteinische Bauernrittertum hingegen
hielt weiterhin beharrlich zu Heinrich dem Löwen. So vertrieb
Adolf III. den neuen Overboden Marcrad II., Sohn von Marcrad I.,
im Jahr 1181.(10) Er verstarb wenige Monate
später im dänischen Exil.(11) In
diese Periode fällt vermutlich auch die Gründung des an
der Eider gelegenen Ortes Dosenrade, die Rodung und kleine Wasserburg
eines gewissen Doso.(12) Im holsteinischen
Kernland hingegen wurde Sirik von Gadeland von Adolf III. als neuer
Overbode eingesetzt.(13)
Als
Kaiser Friedrich Barbarossa im Mai 1189 zum Dritten Kreuzzug ins
Heilige Land antrat, befand sich auch Graf Adolf III. in dem Heer.
Da der inzwischen zurückgekehrte Heinrich der Löwe nicht
teilnehmen wollte, verpflichtete er sich, erneut drei Jahre in die
Verbannung zu gehen.
Kaiser
Barbarossa, der auf dem Kreuzzug im Juni 1189 in Syrien angekommen
war, erlitt im Alter von 68 Jahren einen Herzschlag beim Baden im
Salep und ertrank. Heinrich der Löwe nutzte diese Gelegenheit,
kehrte im September 1189 aus seinem englischen Exil zurück
und beanspruchte ohne nennenswerte Gegenwehr seine alten Rechte.
Die ehemaligen Anführer der Holsten und Stormarner eilten sogar
zu ihm und forderten ihn auf, das Land wieder einzunehmen. Der Löwe
war hoch erfreut und versprach den Nordelbiern für die Zukunft
seine Gunst. Holsten und Stormarner besetzten daraufhin Hamburg,
Plön und Itzehoe. Nur Segeberg widerstand der Belagerung. Sie
zog sich bis in den Winter hinein.
Die
Belagerungstruppen schienen fest unter der Kontrolle des welfischen
Befehlshabers, Walter von Blandensile, zu sein. Doch plötzlich,
vermutlich nach einem 14-tägigen turnusmäßigen Besatzungstruppenaustausch,
wurde dieser von einem an der Stör wohnenden Holsten namens
Eggo Sture und dessen Leuten angegriffen. Sture hatte sich offensichtlich
auf die kaiserliche Seite geschlagen. Ein Strafunternehmen, das
Heinrich der Löwe daraufhin befahl, wurde ein Misserfolg. Die
Nordelbier hingegen gewannen viel Geld, als der von ihnen gefangene
Walter von Blandensile ausgelöst werden musste. Jetzt war das
Ende von Heinrich dem Löwen nah, doch er gab noch nicht auf.
Welche
Überlegungen bei Teilen der Holsten zum Seitenwechsel geführt
hatten und welche Rolle der neue gräfliche Overbode Sirik von
Gadeland dabei spielte, ist unbekannt.(14)
Im
Herbst 1189 traf Adolf III., vom Kreuzzug zurückgekehrt, wieder
in Nordelbien ein. Dort bildete sich eine Partei, die sich auf eine
Zusammenarbeit mit ihm einstellte. Er hatte einen großen Anteil
daran, dass Heinrich der Löwe nicht wieder Fuß fassen
konnte.
Die
Kirche gehörte offensichtlich aus ökonomischen Gründen
zu den Parteigängern des Grafen Adolf III., da sie nach der
Einführung eines feudalen Lehenssystems zahlreiche Zehnten
bezogen. Von der bäuerlichen Führungsschicht hingegen
hatte die Kirche nur unregelmäßige Spenden zu erwarten.
Auch musste im Augustiner-Chorherrenstift befürchtet werden,
dass im Falle einer erneuten Machtergreifung von Heinrich dem Löwen
die Urkundenfälschungen von Probst Sido auffliegen würden.
Die
örtliche Kirche hatte also eindeutig die gräfliche beziehungsweise
kaiserliche Seite ergriffen. So wurden auch in Sidos Kirchenschrift
über die Vision des Bauern Gottschalk neben Graf Gunzel von
Schwerin, dem bedeutendsten Gefolgsmann von Heinrich dem Löwen,
zahlreiche ortsnahe Bauernritter in der Vorhölle gebraten.
Die Feuerstelle erinnert an Bauerneisenschmelzen, wie sie noch in
jener Zeit betrieben wurden.
Die
Visionsschrift des Autors aus Neumünster scheint dann aber
doch außer Landes geschafft worden zu sein, was zu einigen
Spekulationen Anlass gibt.
 Zu
jener Zeit war nämlich noch nicht ganz eindeutig geklärt,
wer letztlich im Konflikt zwischen Staufer und Welfen die Oberhand
gewinnen würde. Für Heinrich den Löwen bestand beispielsweise
die Chance, dass ihm der Englische König, Richard Löwenherz,
nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land zu Hilfe kommen
könnte. Doch dort überschlugen sich ebenfalls die Ereignisse. Zu
jener Zeit war nämlich noch nicht ganz eindeutig geklärt,
wer letztlich im Konflikt zwischen Staufer und Welfen die Oberhand
gewinnen würde. Für Heinrich den Löwen bestand beispielsweise
die Chance, dass ihm der Englische König, Richard Löwenherz,
nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land zu Hilfe kommen
könnte. Doch dort überschlugen sich ebenfalls die Ereignisse.
Als
die arabische Hafenstadt Akko 1191 von englischen, französischen
und deutschen Kreuzrittern eingenommen worden war, begann dort das
normale Gezänk über das Errungene. Der Englische König
Richard Löwenherz und der Französische König Phillip
stellten beide ihre Standarten auf, da sie vereinbart hatten, sich
die Beute des Kreuzzuges gerecht zu teilen. Leopold von Österreich,
der den mitleiderregenden Rest von Barbarossas Kreuzzug anführte,
stellte ebenfalls seine Standarte auf, die Richard jedoch in den
Burggraben warf. Er war nicht bereit, mehr als erforderlich zu teilen,
was ihm noch zum Verhängnis werden sollte. Als Richard Löwenherz
am 9. Oktober 1192 die Heimreise von seinem Kreuzzug antrat, erlitt
er Schiffbruch und war gezwungen, über Land durch das Gebiet
von Leopold von Österreich zu reisen. Obwohl er als Tempelritter
verkleidet war, wurde er in einem Gasthaus erkannt und festgenommen.
Leopold übergab ihn an den neuen Staufer Kaiser Heinrich VI.,
der ihn nach einem Jahr Gefangenschaft für eine enorme Lösegeldsumme
schließlich wieder frei lies.(15)
Jetzt war es für Hilfsmaßnahmen zugunsten Heinrich des
Löwen zu spät.
Die
unsicheren politischen Verhältnisse können der Grund für
die Unterdrückung der Visionsschrift „Godeschalcus“
in Holstein gewesen sein. Vielleicht spielte aber auch der Seitenwechsel
einiger Bauernritterfamilien eine Rolle oder diese gehörten
zumindest zu den Sponsoren der Kirche. Nach Angaben des unter Aufsicht
von Probst Sido verfälschten Güterverzeichnises des Stifts
Neumünster(16) zählten um 1200 zwei
der Höllendelinquenten zu den Mäzenen des Stifts. Eindeutig
festzustellen ist jedenfalls, dass von keinem Autor des Mittelalters
auf Sidos Schrift verwiesen wurde. Die andere Fassung des Nortorfer
Pfarrers ist hingegen mehrfach abgeschrieben worden und beinhaltet
dadurch sehr viele Fehler. Sie wurde bereits im Jahr 1220 von Heisterbach
im „Dialogus miraculorum“ erwähnt.(17)
Im
Folgenden sollen aber überwiegend nur Sidos Schilderungen wiedergegeben
werden, da seine Beschreibungen wesentlich ausführlicher
sind und zudem sehr viel mehr Personen beim Namen genannt werden.
Sein Text dürfte in der Zeit zwischen August und Oktober 1190
geschrieben worden sein.(18)
Die
Schilderung
Im
„Jahre
1188 (27. März) nach
der Fleischwerdung des Herrn (auf dem
Reichstag zu Mainz) nahm der ruhmvolle
Kaiser Friedrich (Barbarossa)
Christi Kreuz und weihte sich zum Kampf gegen
die Feinde dieses Kreuzes in Demut für eine Pilgerfahrt nach
Jerusalem (Dritter Kreuzzug) und unter
dem sonstigen, was er zur Erhaltung des Friedens für das Gemeinwesen
während der Zwischenzeit vorsorglich anordnete, zwang er Herrn
Heinrich (den Löwen),
der Herzog von Bayern und Sachsen geheißen hatte (in
Goslar, im Juli oder August 1188),
das Reichsgebiet auf drei Jahre zu verlassen; denn er war ihm wegen
der früheren Feindseligkeiten verdächtig.
Heinrich
aber machte sich aus der Abwesenheit des Kaisers Hoffnung auf eine
gute Gelegenheit, seine Stellung zurückzugewinnen und kehrte
schon im ersten Jahre nach seiner Ausreise von England (im
September 1189) nach Sachsen zurück.
Er wurde vom Erzbischof Hartwig (II.)
von Bremen (Erzbischof
von 1185 bis 1207) empfangen und erhielt
Burg und Grafschaft Stade mit dem ganzen Lehenbesitz, den er einst
als Herzog von der Bremer Kirche übertragen erhalten hatte,
von ihm zurück. Von dort ging er über die Elbe und gewann
mit Leichtigkeit die Grafschaft Adolfs (III.,
Graf von Holstein 1166 - 1202), der
mit dem Kaiser (Barbarossa)
auf Pilgerfahrt war; denn der stellvertretende
Graf Adolf (I.) von
Dassel fühlte, dass fast das ganze Volk der Holsten innerlich
Herrn Heinrich (den Löwen)
zuneigte und wagte ihm daher keinen Widerstand
zu leisten. Er hatte aber in die Burg Segeberg (in
Holstein) eine Besatzung von Kriegern
gelegt und begab sich mit seinem Gefolge in die Stadt Lübeck
in der Meinung, hier von einer Verfolgung durch Heinrich
(den Löwen) sicher
sein zu können.
 Nun
hatte Herr Heinrich (der
Löwe) schon früher
(nämlich 1180) erlebt,
dass die Burg nicht leicht einzunehmen ist. So beschloss er, da
das ganze Volk der Holsten sich in acht Gruppen (beziehungsweise
Kirchenspiele) gliedert, eine jede
von ihnen solle die Burg für zwei Wochen umlagern, freilich
nicht, um sie zu erobern, sondern nur, um zu verhüten, dass
die Krieger womöglich durch einen Ausfall unserem Land Schaden
zufüge und für sich Beute machten, indem sie zusammenraffen,
was ihnen für ihre Zwecke brauchbar erscheinen mochte. Nun
hatte Herr Heinrich (der
Löwe) schon früher
(nämlich 1180) erlebt,
dass die Burg nicht leicht einzunehmen ist. So beschloss er, da
das ganze Volk der Holsten sich in acht Gruppen (beziehungsweise
Kirchenspiele) gliedert, eine jede
von ihnen solle die Burg für zwei Wochen umlagern, freilich
nicht, um sie zu erobern, sondern nur, um zu verhüten, dass
die Krieger womöglich durch einen Ausfall unserem Land Schaden
zufüge und für sich Beute machten, indem sie zusammenraffen,
was ihnen für ihre Zwecke brauchbar erscheinen mochte.
Wie
Gottschalk zur Burg
(Segeberg) kam,
dort erkrankte und wieder nach Hause gebracht wurde:
In
unserer Pfarrei Neumünster lebte ein Mann mit dem Namen Gottschalk,
ein einfacher, aufrechter Mensch, arm an Geist und Habe, ein Siedler
(und Rodungsbauer) in
der Einöde - und doch kein Einsiedler, sondern einer, der sein
Feld bestellte -, eines einzigen Weibes Mann, neben dem er nie eine
andere Frau angerührt hat; von ihr hat er einen Sohn und zwei
Töchter. An mancherlei langwierigen, schweren Krankheiten hat
er sein ganzes Leben hindurch gelitten; aber in der Zeit seines
Wohlbefindens ist er unermüdlich tätig, Buchen, Eichen
und die anderen Bäume nicht nur (durch
Viehverbiss) kurz zu halten, sondern
mitsamt den Strubben zu roden und so erweitert er (als
freier Bauer) seine Felder, die Saat
zu streuen. Indem er diese Felder bestellt, isst er sein Brot im
Schweiße seines Angesichts. Ihm steht nicht der Sinn nach
fremden Eigentum und er beschafft sich nichts durch Raub und Dieberei,
wie man es unseren Leuten, den Holsten, gern nachsagt: Von seiner
Habe, die er nur durch rechte Mühsal zusammengebracht hat,
teilt er, soweit er es eben kann, in Güte anderen mit.
 Als
nun dem geplanten Turnus entsprechend unsere Pfarrangehörigen
zur Belagerung der Burg abgerufen wurden, wandte sich Gottschalk
- sehr wohl wissend, bei seiner Schwächlichkeit werde er die
Mühsal und Gefahr einer Belagerung nicht durchstehen können
- in eigener Person und durch Vermittler an den Overboden unseres
Landes
(Sirik von Gadeland) mit
der dringenden Bitte, ihm möge mit seiner Erlaubnis gestattet
werden, an diesem Unternehmen nicht teilzunehmen; aber er erreichte
nichts. So bereitete er denn in dieser Zwangslage alles Mögliche
für seine Ausrüstung vor, lud sich alles - sein eigener
Packesel - auf den Rücken (zum
Fußdienst, obwohl er ein Pferd besaß) und
machte sich mit seinen Kameraden auf den Weg, derweilen seine Frau
ihn keifend zurückrief: Aus einem Traumgesicht glaubte sie
zu wissen und verkündete es ihm, er werde nie mehr lebendig
zurückkommen oder unter einer so tödlichen Krankheit zu
leiden haben, dass es für ihn besser sei, schon tot zu sein
als noch weiter zu leben. Er aber gab ihr nicht nach, als sie ihn
zurückhalten wollte und obwohl schon damals der Keim der Krankheit
in ihm steckte, stand er den begonnenen Marsch durch und kam am
Sonntagabend (den
10. Dezember 1189) vor der Burg
(Segeberg) an.
Denn so war es geplant worden, dass stets am Sonntag, nach Ablauf
von zwei Wochen andere antreten und die, die ihren eigenen Dienst
abgeleistet hatten, heimkehren sollten. Als
nun dem geplanten Turnus entsprechend unsere Pfarrangehörigen
zur Belagerung der Burg abgerufen wurden, wandte sich Gottschalk
- sehr wohl wissend, bei seiner Schwächlichkeit werde er die
Mühsal und Gefahr einer Belagerung nicht durchstehen können
- in eigener Person und durch Vermittler an den Overboden unseres
Landes
(Sirik von Gadeland) mit
der dringenden Bitte, ihm möge mit seiner Erlaubnis gestattet
werden, an diesem Unternehmen nicht teilzunehmen; aber er erreichte
nichts. So bereitete er denn in dieser Zwangslage alles Mögliche
für seine Ausrüstung vor, lud sich alles - sein eigener
Packesel - auf den Rücken (zum
Fußdienst, obwohl er ein Pferd besaß) und
machte sich mit seinen Kameraden auf den Weg, derweilen seine Frau
ihn keifend zurückrief: Aus einem Traumgesicht glaubte sie
zu wissen und verkündete es ihm, er werde nie mehr lebendig
zurückkommen oder unter einer so tödlichen Krankheit zu
leiden haben, dass es für ihn besser sei, schon tot zu sein
als noch weiter zu leben. Er aber gab ihr nicht nach, als sie ihn
zurückhalten wollte und obwohl schon damals der Keim der Krankheit
in ihm steckte, stand er den begonnenen Marsch durch und kam am
Sonntagabend (den
10. Dezember 1189) vor der Burg
(Segeberg) an.
Denn so war es geplant worden, dass stets am Sonntag, nach Ablauf
von zwei Wochen andere antreten und die, die ihren eigenen Dienst
abgeleistet hatten, heimkehren sollten.
Am
Dienstag
(den 12. Dezember 1189) zur
Abendstunde überfiel ihn zum ersten Mal schwere Fieberschauer,
dann entschwand seinen Gliedern allmählich die Kraft und er
streckte sich schließlich auf sein Lager; gleichwohl war er
noch bei Sinnen und verlor auch bis zum nächsten Sonntag
(den 17. Dezember 1189) nicht
die Sprache. Immer wieder sahen seine Zeitgenossen nach ihm, denen
seine Krankheit herzlich Leid tat; ein Priester (vermutlich
der Pleban der Marktkirche von Segeberg) wurde
gerufen und er stärkte ihn mit dem Sakrament des Leibes Christi:
Seit er sich niedergelegt hatte, war das die einzige Speise, die
er zu sich nahm, bis er sich schließlich irgendwie wieder
erholte. Von Sonntag bis Mittwoch (den
17. bis 20. Dezember 1189) aber schwanden
ihm alle Sinne, sein Gesicht wurde bleich, die Zunge verstummte,
der Pulsschlag verlangsamte sich, das Denken setzte aus und der
ganze Leib wirkte, als sei er entseelt. Am Mittwoch entströmte
seine Seele, wie der Kranke es selbst bezeugt, vollständig
dem Gefäß des Leibes, um Unsichtbares zu sehen, Unsagbares
zu Hören ... .
Am
Sonntag
(den
24. Dezember 1189), der für unsere
Pfarrangehörigen der letzte Tag bei der Belagerung der Burg
und für Gottschalk der Letzte seiner Vision war, machten sich
alle zusammen zur Heimkehr auf und seine Freunde hoben ihn auf einen
Karren und schickten sich an, ihn nach Hause zu bringen. Als sie
aber auf ihrem Marsch an unserer (St.
Marien) Kirche (in
Neumünster) vorbeikamen und sie
aus der Nähe sahen, erörterten sie ernsthaft untereinander,
ob sie ihn zur Abkürzung der Schinderei nicht schon jetzt zur
Kirche bringen sollten, um ihn so zu begraben: Wenn sie ihn erst
nach Hause brächten, nur um ihn, wie sie meinten, am nächsten
Tage zur Beerdigung wieder zur Kirche zurückzuschaffen, brauchten
sie doch nicht eine doppelte Arbeit aufzuladen; denn sein Dorf
(Groß)Harrie
liegt eine gute Meile (also
rund 7 km) von Neumünster entfernt.
Trotzdem, in einem vernünftigeren Entschluss, wie es sich zum
Ende erweisen sollte, fuhren sie ihn nach Hause. Dass immerhin mit
einem Menschen unter Menschen und von Menschen derart verfahren
worden ist, das ist durch sehr viele Leute bezeugt.
Welch
ein Erlebnis aber unterdessen seine Seele gehabt hat nach dem Willen
dessen, der allein große, wunderbare Dinge tut, das will ich
vor dem, der es lesen will und zu wissen wünscht, getreulich
ausbreiten, so wie ich es aus seinem eigenen wahrhaftigen Bericht
mehrfach vernommen habe; denn die Herzenseinfalt des Mannes, dem
es fremd ist, gewunden daherzureden, die Sauberkeit seiner Worte,
die zu den Dingen stimmt und nicht vom Glauben abweicht, seine unablässigen
Seufzer und die Fülle seiner Tränen stellen dem Berichtenden
das Zeugnis der Wahrhaftigkeit aus.
Gottschalks
Vision
Von
den beiden Engeln, die ihn geleiteten:
In
der zweiten Woche seiner Krankheit, am Mittwoch
(den 20. Dezember 1189),
traten zwei Engel, schön von Angesicht, in schneeweißem
Gewand, in gemessener Haltung, gelassenen Schrittes freundlich auf
ihn zu, gar nicht, als ob er ein Fremder sei. Der eine von ihnen,
der sich ihm auch in der Folge dienstwillig zu erweisen pflegte,
fasste ihn bei der rechten Hand; der andere, der sich allein für
ihn ansprechlich zeigte, fasste ihn bei der linken Hand und forderte
ihn auf, sie zu begleiten. Als er sich ohne irgendwelche Angst sogleich
fügte und nur besorgt fragte, wohin sie ihn denn bringen wollten,
gab jener zur Antwort, darüber brauche er sich keine Sorgen
zu machen, und er ermahnte ihn, ihnen nur ohne Zagen zu folgen.
So nahmen sie ihn denn in die Mitte und führten ihn an der
Hand, ohne dabei mit ihm oder untereinander zu sprechen: Schweigend
legten sie einen Weg von annähernd zwei Meilen
(beziehungsweise 14 km zurück),
in der Richtung von Norden gen Süden."(19)
Auf
den folgenden Seiten berichtet Sido über die weiteren Erlebnisse
des Bauern Gottschalk im Jenseits, das topographisch betrachtet
an vielen Stellen Ähnlichkeiten mit dem Kirchplatz von Neumünster
aufweist.
Zusammenfassend
kann erläutert werden, dass Gottschalk im Jenseits Bäume
voller Schuhe, eine tiefgoldene Basilika und ein unsäglich
schönes Licht sah. Zwei Leidensstationen musste der Bauer zunächst
erleben, eine Dornenheide und einen Schreckensfluss. Einen ähnlichen
Fluss kennen wir aus der Völuspa, der Seherin Gesicht, der
Edda und auch der dänische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus
weiß von einem solchen voller Waffen starrenden Strom in der
Unterwelt zu berichten.(20)
Es
ist kaum vorzustellen, dass ein einfacher Bauer über solche
dichterischen Qualitäten beziehungsweise Literaturkenntnisse
während einer Vision verfügt haben soll. Die Indizien
sprechen vielmehr für ein politisches und literarisches Werk
des intellektuellen Probstes des Augustiner-Chorherrenstifts von
Neumünster, der im Konflikt zwischen Staufer und Welfen Partei
ergriffen hat. Einen wahren Kern wird die Visionsschrift jedoch
beinhalten. Warum sonst sollte der Autor seinem Visionär und
wie wir noch sehen werden, seinem größten Sünder,
den gleichen Namen gegeben haben. Sie heißen beide Gottschalk,
was so viel bedeutet wie Gottes Knecht.
Im
weiteren Verlauf des Visionstextes werden die „Guten"
über die Leidensstationen geleitet und die „Bösen"
beziehungsweise die Anhänger der Welfen entsprechend ihrer
Sünden erbärmlich bestraft. So sah Gottschalk, dass Mörder
ihre Opfer im Jenseits ständig auf dem Rücken tragen mussten.
Im Vergleich zu anderen geschilderten Folterungen, eine eher harmlose
Bestrafung. Schließlich gelangte Gottschalk zur dritten Leidensstation,
einem Feuerfolterplatz und erlebte dort Folgendes:
„Von
der Pein des Feuers und von denen in ihm Bestraften:
Denn
es war da ein Feuer, nicht zu messen seine Hitze, sein Graus und
Schrecken ... Noch bevor seine Substanz die Büßer berührte,
die in ihm brennen sollten, ließ die aus ihm hervorströmende
Hitze sie weiß glühend werden. ... Gottschalk, dem von
seinen Führern in ziemlicher Entfernung, aber doch näher,
als ihm lieb sein mochte, ein Platz angewiesen worden war, wurde
von der Hitze des Feuers an der linken Seite ein bisschen gestreift;
er konnte die Pein nicht ertragen, entsetzte sich vor den Folterknechten
... und unter lautem Wehgeschrei brüllt er, jetzt werde er
brennen, jetzt sei es aus mit ihm und er fleht unter Tränen,
man möge ihn schleunigst wegbringen ... . Das erreichte er
... auch ... . Als er nun an einem Platz stand, der mehr Sicherheit
bot, sprach ihm der leutselige Engel gut zu und versicherte ihm,
weiter werde er nichts zu fürchten brauchen, er sagte, er sei
ja nicht deswegen hierher gebracht worden, um diese schwere Strafe
auf sich zu nehmen, sondern dass er sie nur mit ansehe und dadurch
andere wappnen könne, dem Bösen zu entsagen und das Gute
zu tun und sich so davor zu schützen, jemals an diese Folterstätte
zu kommen. Durch diesen Zuspruch gewann er an Selbstsicherheit,
dachte fleißig über alles nach, was dort vor sich ging
und fragte sorglich nach dem Sinn einzelner Vorgänge, die er
nicht begriff ... .
Außerdem
fanden sie dort gegen dreißig Menschen vor, von denen einige
erst kürzlich dorthin gekommen waren, während andere von
der Strafe in den Zustand der Ruhe übergegangen, jetzt aber
wieder zur Bestrafung zurückgekehrt waren. Zu ihrer Zahl, also
zu den Letzteren gehörten der
(bedeutendste Gefolgsmann Heinrichs des Löwen)
Graf Gunzelin (Guncelinus
comes), der Overbode von Holstein Marcrad
(II.) der
Jüngere (Marcradus junior prefectus
Holsacie), der Vogt Reimar (Reinmarus
advocatus), der Bode Daso (Daso
rector), Daso der Lange und andere
(Daso altus et alii),
die Gottschalk dort von der Person her wieder erkannte. Sie alle
wurden schwer, aber in verschiedener Weise gepeinigt. Denn manche
von ihnen wurden wie die Erstgenannten, andere an diesen oder jenen
Gliedern, an einem oder mehreren gebrannt, also so, dass mancher
nur an der Hand, ein anderer am Fuß, der Dritte am ganzen
Bein den Brandschmerz verspürte. Als Gottschalk seinen Dolmetscher
wissbegierig nach dem Sinn dieses unterschiedlichen Verfahrens fragte,
wurde er von ihm zwar sorgfältig über alles aufgeklärt,
aber wegen der Vielfalt der Fälle hat er es vergessen; jedoch
sagt Gottschalk, wer auf einer Seite, dass heißt an der Hälfte
des Körpers gestraft worden sei, sei des Ehebruchs schuldig,
der an den Füßen Gepeinigte sei auf verbotenen Wegen
gegangen und habe dadurch einen Bann gebrochen; wer mit dem Bauch
ins Feuer getaucht worden sei, sei ein Schlemmer und Trunkenbold,
wer an den Händen gebrannt worden sei, ein Dieb gewesen, und
ganz allgemein, wie es die Autorität der Heiligen Schrift bezeugt,
sei jeder eigens an dem Glied gestraft worden, das vornehmlich an
seiner Sünde Schuldig geworden sei.
Vom
Dasoniden Gottschalk
Unter
allen jedoch, die sich beim Feuer fanden, hatte einer, Gottschalk,
ein Sohn Dasos des Älteren
(Daso
de Ennigge), von
dem die Dasoniden ihren Familiennamen angenommen haben (Godeschalcus
Dasonis senioris filius, a quo Dasonida cognomen acceperunt),
vor den Übrigen die allerschlimmsten Strafen zu erleiden. Er
war nämlich - nur das Gesicht ausgenommen - in einen Glaskolben
gesperrt worden und konnte keines seiner Glieder bewegen. Wie er
derart in der engen Röhre steckte, warfen ihn drei von den
Folterknechten in die eine der Ecken des Feuers, sie griffen sich
mit den übrigen sechs Folterknechten neun riesige Blasebälge
und setzten sie auf den beiden jenes Winkels in Betrieb und mit
aller Kraft fachten sie, einander noch aufmunternd, das Feuer immer
wieder an ... .
Als
unser
(Bauer)
Gottschalk die schlimmste Folterung seines
Namensvetters mit ansah, fragte er den Engel, was der denn verbrochen
habe, dass er derart leiden müsse und er erhielt zur Antwort,
der Heilige Martin sei der Anlass für sein schlimmes Los, weil
er ihn nämlich einmal in betrügerischer Absicht verkauft
habe. Überdies, setzte der Engel
hinzu, erdulde er solche Strafe schon, seit er gestorben sei und
werde bis zum Jüngsten Tage leiden müssen und jeden Tag
siebenmal so grausam gefoltert werden.
Da
ja nun der Dasonide, der unser Zeitgenosse ist, den Heiligen Martin
(von Tour, Begründer des ersten Mönchklosters
in Gallien, der 371 zum Bischof ernannt wurde) nicht
zu Gesicht bekommen hat, ist zum Verständnis ein Hinweis erforderlich,
was der Engel mit dem Verkauf gemeint hat."
(Der
Dasonide war nämlich rund 30 Jahre zuvor in eine Affäre
verwickelt worden. Er hatte die von der Sippe der Bakariden aus
der Kirche von Nortorf gestohlenen Gebeinsfragmente des Heiligen
Martin für sechzehn Mark erwerben können und wollte von
der Kirche für die Rückführung der Reliquie die Summe
erstattet bekommen. Dadurch geriet er selber unter Verdach und sollte
mittels einer Feuerfolterung seine Unschuld beweisen.)
„Aber
als sie
(der Dasonide und ein ebenfalls verdächtigter
Mann namens Hubiko) bei uns
(in Neumünster) am
festgesetzten Tage erschienen, um in Gegenwart des Grafen ihre Unschuld
durch ein solches Beweismittel zu erhärten, verschob der Graf
auf Einspruch der Chorherren unseres Hauses das Gericht, wenn auch
gegen seinen (Graf Adolf II.)
Willen und später verlangte er es nicht
mehr von ihnen, da irgendetwas dazwischenkam"(21)
(bzw. der Graf während eines Fedzuges
am 6. Juli 1164) „zum
Tode getroffen"(22)
(wurde).
In
der anderen Textfassung über die Vision des Bauern Gottschalk,
die etwas später vermutlich auf der Grundlage der ersten Fassung
von dem Pfarrer aus Nortorf geschrieben wurde, wird die Geschichte
des Reliquienraubes in nur wenigen Sätzen geschildert. Die
Dasoniden finden in ihr keine namentliche Erwähnung. Hier wird
lediglich von einem Mitwisser gesprochen, der zu den führenden
Leuten des Landes gehörte. Dafür wird in dieser Fassung
ausführlicher auf die vermeintlichen Untaten des Overboden
Marcrad II., Holstenanführer von 1170 bis 1181/82, eingegangen.(23)
Auffällig
ist in diesem Zusammenhang, dass der Autor Sido aus Neumünster
seinen schlimmsten Sünder im Kirchspiel Nortorf und somit auf
dem Territorium des ehemaligen Bodebezirks des Boden Daso ausmachte.
Der Nortorfer Autor hingegen die Missetaten des Overboden aus Arpsdorf
bei Neumünster ausführlich schilderte.
Der
Verdacht liegt nahe, dass die beiden Kirchenmänner solche Darstellungen
wählten, um nicht zu großen Anstoß in der ortsansässigen
Bevölkerung ihrer Gemeinden zu nehmen.
- Vgl.
Walther Lammers, Gottschalks Wanderung im Jenseits, Wiesbaden,
1982, S. 152-153
- Vgl.
Hans Braunschweig, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, Neumünster, 2003, Bd. 128, S. 18-19
- Vgl.
Wolfgang Prehn, Gesellschaft, Wirtschaft und Verfassung in Altholstein,
Diss. Hamburg, 1958, S. 147, vgl. Heinz Ramm, Landschaft, Großkirch
und Burgvogtei, Diss., Hamburg, 1952, S. 119, vgl. Walther Lammers,
Das Hochmittelalter bis zur Schlacht von Bornhöved, Neumünster,
1981, S. 58 und vgl. Enno Bünz, in: Zeitschrift der Gesellschaft
für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster,
1994, Bd. 119, S. 32 - 51
- Vgl.
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 10 u. 26
- Alexander
Heine, Helmold, Chronik der Slaven, Essen, 1990, Nr. I 79, S.
221
- Vgl.
Enno Bünz, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, Neumünster, 1994, Bd. 119, S. 67 u. 94
- Vgl.
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 10-16
- Vgl.
Alexander Heine, Helmold, Chronik der Slaven, Essen, 1990, Nr.
II 100, S. 284-285
- Vgl.
Hansgeorg Loebel, Niedersachsen, Hameln, 1984, S. 27
- Vgl.
E. Hoffmann, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, Neumünster, 1975, Bd. 100, S. 39
- Vgl.
Walther Lammers, Das Hochmittelalter bis zur Schlacht von Bornhöved,
Neumünster, 1981, S. 370-374
-
Vgl. Wolfgang Laur, Historisches Ortsnamenslexikon von Schleswig-Holstein,
Neumünster, 1967, S. 217,
Walther Lammers, Das Hochmittelalter bis zur Schlacht von Bornhöved,
Neumünster, 1981, S. 77,
Paul von Hedemann, Heimatbuch des Kreises Rendsburg, Rendsburg,
1922, S. 328
-
Vgl.
Irmtraut Engling, Das Neumünster-Buch, Neumünster, 1985,
S. 34
-
Vgl. Walter Lammers, Das Hochmittelalter bis zur Schlacht von
Bornhöved, Neumünster, 1981, S. 370-376
-
Vgl. Terry Jones, Die Kreuzzüge, Augsburg, 2000, S. 180 ff.
- Vgl.
Enno Bünz, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, Neumünster, 1994, Bd. 119, S. 37 und vgl. Wolfgang
Prehn, Gesellschaft, Wirtschaft und Verfassung in Altholstein,
Diss. Hamburg, 1958, S. 147
-
Vgl.
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 17 u. 35-37
- Vgl.
Walther Lammers, Gottschalks Wanderung im Jenseits, Wiesbaden,
1982, S. 7
-
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 47-55
-
Vgl. Walther Lammers, Gottschalks Wanderung im Jenseits, Wiesbaden,
1982, S. 148 u. 154
-
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 73-87
-
Alexander Heine, Helmold, Chronik der Slaven, Essen, 1990, Nr.
II 100, S. 285
- Vgl.
Erwin Assmann, Godeschalcus und Visio Godeschalci, Neumünster,
1979, S. 177 - 179

|
|